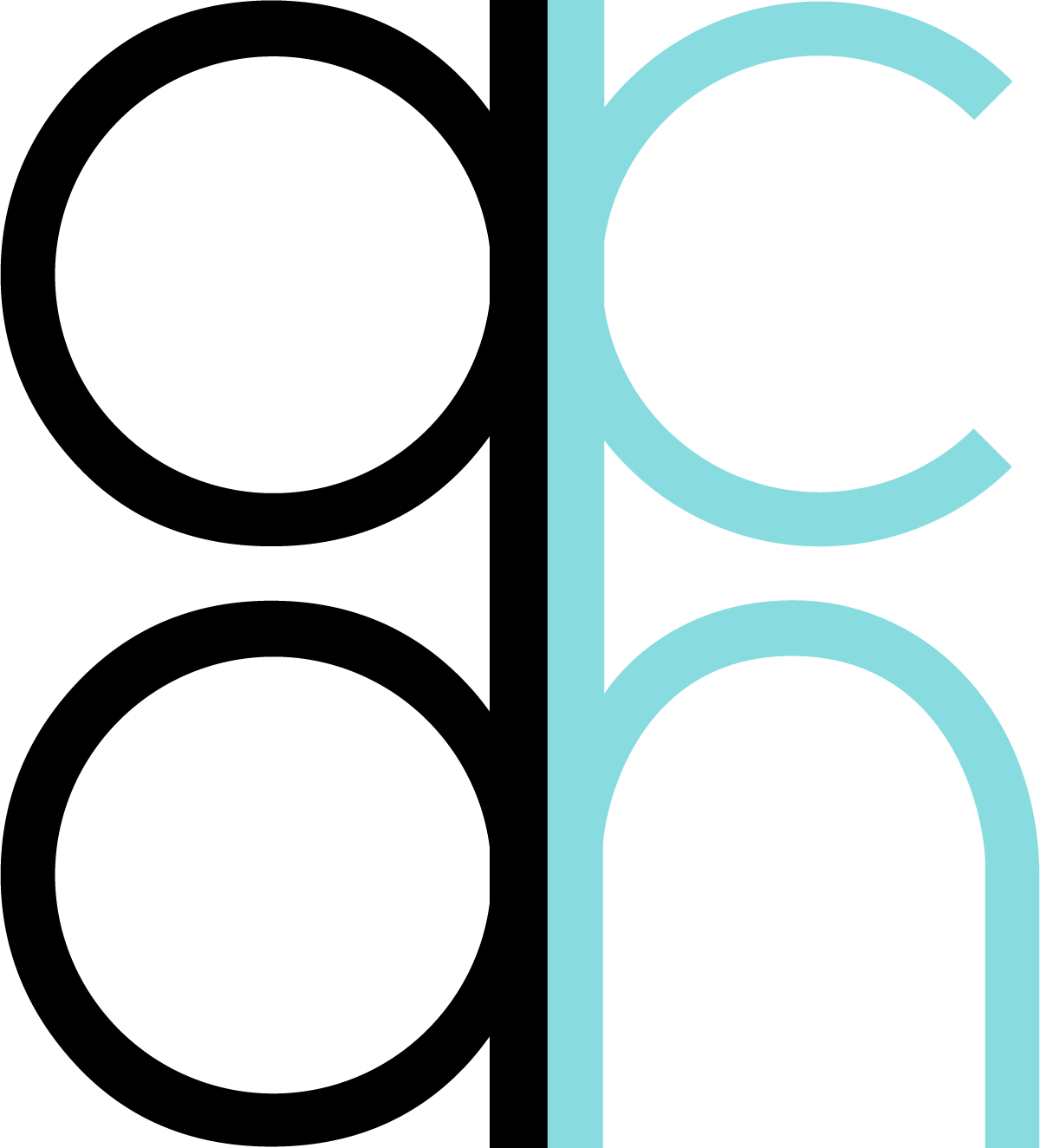Das Wintersemester ging zu Ende und Ostern steht vor der
Tür. Da wollen wir wieder einen Rundbrief an Euch senden. Sehr
viele von Euch haben uns ja indessen geschrieben. Euer Dank,
Eure Fragen und Eure kleinen Arbeiten machen uns immer Freude.
Es ist nun schon ein recht ansehnlicher Schriftwechsel auf diese
Weise im Gang. Er wird täglich größer, weil fast jeden Tag neue
Fernbetreute hinzukommen. Und das ist recht so. Hier findet sich
ein Kreis von Gleichstrebenden zusammen – und es sind ja meist
die großen Idealisten, denen ein schönes, großes Ziel vor Augen
steht -, die einmal, nach ihrer Rückkehr, besonders gut zusammen-
passen werden, weil sie indessen immer wieder zu gleichen Frage-
stellungen geführt wurden, und weil sie letztlich der Grundidee
nach Ähnliches wollen. Eine ganz große Freude war es uns, daß
gerade in der letzten Zeit schon eine ganze Reihe der fernbetreuten
Kameraden auf Dienst- oder Urlaubsreisen unser Zentralinstitut
besichtigten. Sie wissen nun schon, wo und wie sie künftig bei uns
arbeiten werden.
Nun wollen wir Euch zunächst wieder berichten, was wir in
der Zwischenzeit getrieben und gearbeitet haben.
Prof. Kindermann hielt eine dreistündige Hauptvorlesung
über „Das deutsche und europäische Theater des Mittelalters“.
Er führte vorerst in das Kultspiel der Germanen ein und zeigte sowohl
die starken Wirkungsenergien, die von dorther in das deutsche Theater
des Mittelalters führen, als auch das Weiterleben in vielen Brauchtümern
und Volksspielen bis zum heutigen Tag. Dann aber wurde ausführlich
auf das deutsche Theater des Mittelalters selbst eingegangen und ver-
gleichend das französische, italienische, englische, niederländische
und spanische danebengerückt. In jedem Fall wurde nicht nur die geschicht-
liche Entwicklung herausgearbeitet, sondern auch das für diese Nation
Typische der Vorwürfe, der Spielleitung, des Bühnenbildes usw. betont.
Viele Lichtbilder erläuterten diese Ausführungen. Als im reifen Mittel-
alter die Kirche, in der Absicht, die Heilswahrheiten versinnlichen zu
lassen, Mysterienspiele, vorerst streng liturgischen Charakters, einführte,
traten die theatralischen Möglichkeiten aller großen Nationalkulturen noch
als Gleichstrebende nebeneinander. Die gleiche lateinische Sprache, die
gleichen liturgischen Voraussetzungen schienen im ersten Augenblick in
Deutschland und in Frankreich, in England und in Italien oder Spanien
genau die gleichen theatralischen Formen hervorzubringen. Aber es han-
delte sich lediglich um jene geschichtliche Minute der scheinbaren Gleich-
wertigkeit und Gleichberechtigung, die im Augenblick knapp vor dem
Start alle die Teilnehmer am Wettbewerb in scheinbar gleicher Stellung
an der gleichen Barriere nebeneinander gereiht sieht. Im Grunde aber
trägt schon in diesem Augenblick jeder der künftigen Rivalen sein eigenes
Gesetz in sich, seine eigene Spannkraft und Dynamik, seinen eigenen Weg
und sein eigenes Ziel.
Die Kirche hatte ja in diplomatischer Anpassung diese scheinbar
gleichförmigen theatralischen Versuche in jedem einzelnen Fall auf kul-
tischen Brauchtümern aufgebaut, die der betreffenden Nation schon in
vorchristlicher Zeit zu eigen waren. So wurde recht bald schon die litur-
gische Gleichartigkeit des religiös-mittelalterlichen Spiels bei den einzelnen
Völkern durchbrochen. Nicht nur die Kleriker sollten spielen und dar-
stellen dürfen – das Volk selbst wollte spielen und darstellen. Und nicht
nur das geheimnisumwobene, nur dem engsten Kreis verständliche Latein
sollte da Geltung haben, sondern in der Volkssprache sollte gespielt wer-
den. Die überall neu aufblühenden Städte traten als Mäzene in die
Bresche. Und typisch spätmittelalterlicher Bürgergeist erfüllte diese Spiel-
freude in Frankreich genau so wie in Deutschland, in Italien und Spanien
genau so wie in England und in den Niederlanden. Und wiewohl es nun
überall die Patrizier und Meister mit Stolz erfüllte, einmal im Jahr als
Herodes oder als Pilatus verkleidet vor all die Mitbürger hintreten und
dabei die Bürgersehnsucht nach der Herrscherwürde, vielleicht sogar nach
dem Tyrannengestus auswirken zu können; und wiewohl es überall den
Handwerksburschen die gleiche Freude machte, als wilde Teufelsgestalten
die zaghaften Mitbürgergemüter zu erschrecken oder als komische Kauf-
mannsgestalten, als karikierte Juden oder als feige Wächter allenthalben
zur Belustigung beizutragen – es brach doch in jedem einzelnen Fall
soviel des altüberkommenen völkischen Eigengutes durch, daß sich die
theatralischen Ziele und Gestaltungsformen trotz der scheinbar gemein-
samen Vorwürfe und Kirchenfeste in kurzem schon weitgehend trennten.
Die deutschen Spiele bleiben nach wie vor naiv und holzschnittmäßig;
die französischen dagegen offenbaren früh schon den Zug zu raffinierter
und wohlüberlegter Effektsucht. Der symbolischen Andeutungsform, die
auch noch in den ganz weltlich und realistisch gewordenen deutschen
Spielen die eigentliche Grundform bleibt, steht in Frankreich ein scharf
begründendes Kausalitätsprinzip gegenüber, das die französische Raison
zur Richterin erhebt und im Darstellerischen infolgedessen die noch viel
ausgeprägtere Schaulust mit realistischen Details bis ins kleinste befrie-
digen muß. Schon tritt der Bühnenmaschinist in Frankreich in seine
Rechte, um mit einer Fülle von szenischen Tricks die Wunderwelt höchst
realistisch vorzuzaubern. Wie so ganz anders wirkt es daneben, wenn im
deutschen Spiel auf dem Marktplatz das sogenannte dolium, ein großes
Faß, bald einen Berg und bald eine Tempelzinne, bald den Thron Satans
und bald die Rednertribüne des Konklusors darstellt.
Die deutsche Schauspielkunst des Mittelalters geht, so wie die engli-
sche, von Typengestalten aus, die erst ganz langsam aus ihren Gruppen-
profilen ein besonderes Einzelantlitz wachsen lassen. Die französische
Schauspielkunst des Mittelalters geht, gemäß der ausgeprägt indivi-
dualistischen Geisteshaltung der Franzosen, von Anfang an auf
scharfe Rollenindividualisierung aus. Das deutsche und das englische Spiel,
aber auch das niederländische und spanische, lassen Ernstes und Komisches
ineinander übergleiten. Die Spanier kennen die komische Person sogar
bei der Aufführung in der Kirche. Das französische und italienische Spiel
trennen die ernsten und die komischen Szenen scharf voneinander. In
Deutschland, in England und in Spanien bildet jede einzelne Landschaft
ihre eigenen und mit besonderen Szenen und Gestalten ausgestatteten
Spielformen aus. In Frankreich war damals schon alles in Paris, in Italien
alles in Florenz zentralisiert. Die Provinz hatte nur nachzuahmen.
Die Deutschen inszenierten ihre entwickelteren Spiele über den ganzen
Marktplatz hin, indem sie die „loca“, die einzelnen symbolischen Schau-
plätze, kubisch aufgebaut über den ganzen Platz verteilten. Das Volk
sieht von den Fenstern zu oder steht lose herum, drängt oft in den Spiel-
raum herein – und Spieler und Publikum werden immer wieder zur
untrennbaren Gemeinschaft. Die Engländer verwenden die kubische
Wagenbühne. Die Franzosen und Italiener aber gehen auf präzise Bild-
wirkung aus und bauen alles auf eine, dem heutigen Guckkastensystem
schon näherkommende flächige Simultanbühne. Ist für die deutsche Spiel-
wirkung selbst noch im volkstümlichsten Spiel die Idee die wirksame
Trägerin, für das italienische Spiel ist in erster Linie die prachtvolle Aus-
stattung maßgeblich. Das deutsche und das englische Spiel ist anonymer
Herkunft; das französische und italienische aber kennt schon die einzelnen
Autoren; das italienische, freilich auch das niederländische, kennt vor
allem auch schon jene oft sehr bedeutenden Maler und Bildhauer, die,
so wie Brunelleschi in Italien und die Angehörigen der Lukas-Gilde in
den Niederlanden, für eine Bühnenmaschinerie von hohem künstlerischem
Wert sorgen.
In Deutschland, in den Niederlanden und in England wirken bei der
Verweltlichung viele Formen des Kultspieles der Germanen nach; in
Frankreich, Italien und Spanien kehrt schon gar manche Spielform in das
Amphitheater der Antike zurück oder holt sonst aus der Motiven- und
Auffassungswelt der Antike früh schon seine Anregungen.
So bildet trotz des scheinbar gemeinsamen Ausgangsortes jede der
großen europäischen Kulturnationen schon im Mittelalter ihre volksbeding-
ten Sonderformen des theatralischen Lebens aus, von denen im Kolleg
dann besonders ausführlich gesprochen wurde.
In den Seminarübungen der Oberstufe hatte Prof.
Kindermann diesmal das Thema „Wesen und Geschichte
der Regie“ angesetzt. In einer größeren Zahl von Referaten
führte da der Weg von der Inszenierung der mittelalterlichen Spiele
über die Probleme der Hans-Sachs-Bühne und des Barocktheaters
zu den Bühnenformen der Neuberin, Ekhofs und Schröders, zu
den Mannheimer und Weimarer Regieprinzipien, zu denen Schrey-
vogels und Immermanns und von da in großen Zügen über die
Inszenierungsideale Richard Wagners und der Meininger bis zur
Gegenwart. Die vergleichenden Betrachtungen ergaben allmählich
ein eindringliches Entwicklungsbild. Wir hoffen, im Lauf des näch-
sten Semesters aus diesen Referaten für die fernbetreuten Kame-
raden ein Skriptum: „Geschichte der deutschen Regie“ zusammen-
stellen zu können.
In den Seminarübungen der Unterstufe war von
Prof. Kindermann das Thema „Deutsche Schauspiel-
kunst des 19. Jahrhunderts“ angesetzt worden. In einer
Fülle von Referaten, die meist von Bilddemonstrationen begleitet
waren, wurden da die wichtigsten Vertreter der deutschen Schau-
spielkunst von den Großen des romantischen Theaters bis zu jenen
Reihen der noch lebenden älteren Generation, die noch im 19. Jahr-
hundert wurzelt, in ihrem künstlerischen Entwicklungsgang, ihrer
spezifischen Eigenart und ihrem Beitrag zur Gesamtentwicklung der
Schauspielkunst analysiert. Auch hier entstand so das Wandelbild
eines großen Zusammenhangs und eines allmählich sich heraus-
kristallisierenden, freilich vielschichtigen Jahrhundertgepräges.
Doz. Börge hielt sowohl ein Kolloquium über praktische
Dramaturgie als auch eine Einführung in die Filmkunde.
Zunächst das Kolloquium über Praktische Dramaturgie:
1. Wir haben uns erst klar gemacht, welche Position das Fach
Dramaturgie innerhalb der Theaterwissenschaft einnimmt. Dramaturgie
definieren wir als die Wissenschaft vom aufgeführten Drama – vom
„Gesamtkunstwerk“ (Wagner).
2. „Dramaturgie als Wissenschaft“ von Dr. Hugo Dinger, Leipzig 1904,
muß vorläufig als wissenschaftliches Hauptwerk der Dramaturgie gelten.
Wir haben uns eingehend mit den Problemen, die hierin erörtert sind,
besonders „Dramatische Kunst als Sonderkunst“, beschäftigt. Als Grund-
text haben wir „Hanneles Himmelfahrt“ betrachtet, weil gerade dieses
Traumdrama im
Schönbrunner Schloßtheater von Dr. Börge inszeniert
worden ist. Von diesem Texte aus haben wir unsere konkreten Beispiele
geholt. Wir haben gesehen, wie es die Aufgabe des praktischen Drama-
turgen ist, eng zusammenzuarbeiten mit dem Regisseur und dem Bühnen-
bildner. Endlich haben wir uns mit den schauspielerisch-darstellerischen
Problemen auseinandergesetzt und gezeigt, wie diese wieder von den
Raummöglichkeiten der betreffenden Bühnen abhängig sind: die
Striche, die ein Dramaturg macht, dürfen nicht
Schreibtischarbeit sein. Sie müssen diktiert werden
von einem inneren küstlerischen Gefühl der Ge-
samtwirkung des Dramas mit „den“ Schauspielern, in
„der“ Raumregie usw.
3. Aus einer wahren praktischen Dramaturgie entsteht eine wahre
wissenschaftliche Dramaturgie. Unsere „Hanneles Himmelfahrt“ hat uns
Gelegenheit gegeben, Diskussionen zu führen über viele der dramatur-
gischen Probleme, die seit Lessing in Deutschland angeregt worden sind.
Wir haben uns aber nicht nur mit Aristoteles und Lessing, sondern auch mit
Herder, der das Drama vom Zweckprinzip befreit hat, beschäftigt. Unsere
Diskussionen haben Schillers Weg von der „Schaubühne als moralische Anstalt“
über das enge Moralische zum Erhabenen veranschaulicht.
Wir haben nach dem Erhabenen in „Hannele“ gefragt. Es ist gerade vor-
handen in gewissen Szenen von Hauptmanns mystischen Dramen „Die
versunkene Glocke“, „Hanneles Himmelfahrt“ und „Und Pippa tanzt“.
Wir haben Gerhart Hauptmanns Verhältnis zu Goethe gestreift und ge-
sehen, wie die Dramaturgie in „Hanneles Himmelfahrt“ etwas Gemein-
sames hat mit der Dramaturgie der Romantiker (A. W. Schlegel
fordert das religiöse Drama), trotzdem er ein Naturalist ist und als Na-
turalist angefangen hat.
Die Übung zur Dramaturgie des Films beschäftigte sich haupt-
sächlich mit dem Wesen des Stummfilms. Im nächsten Semester soll der
Tonfilm behandelt werden. Ziel ist ein eigener Vorführungsraum mit
großem Anschauungsmaterial. Produktionsleiter aus Berlin haben ihre
Unterstützung zugesagt. In seiner Vorlesung „Das Wesen des Films“
zur Kunstbetrachtung des Films hat Dr. Börge die grundsätzliche Frage
aufgerollt: Gibt es eine Filmwissenschaft? Die Skeptiker
meinen nein. Sie verneinen überhaupt, daß Film Kunst sein kann. Mit
dieser Frage haben wir uns eingehend beschäftigt. Denn hier ist des Pudels
Kern: wenn Film trotz allen Kitschfilmen und minderwertigen Produkten
Kunst sein kann, gibt es eine Filmwissenschaft, die zur Ästhetik gehört.
Wir meinen vorläufig festgestellt zu haben, daß der Film zweifelsohne
in besten Augenblicken als eine photographierte darstellerische Kunst
betrachtet werden muß. Wir arbeiten mit einer Dramaturgie des
Bildes, denn Film ist die Kunst des Sehens, sagt der ungarische Film-
theoretiker Balasz. Das Optische ist das Entscheidende im Film.
Die Frage Theater und Film, Schauspielkunst und Regie im Film und
im Theater ist natürlich für uns Theaterwissenschaftler wichtig. In dieser
Verbindung haben wir uns kritisch auseinandergesetzt mit Walter Freis-
burgers „Theater im Film“. Wir haben festgestellt, daß das Drama sich
weniger für den Film eignet als der Roman, weil der epische Stoff des
Romans eine Fülle von Bildern enthält. Das bedeutet aber nicht, daß der
Film nicht dramatisch sein soll.
In Verbindung mit einer Betrachtung des Nahbildes wurde das
Problem Maske und Mimik im Theater und Film erörtert.
Nach einer Berücksichtigung der schon existierenden Filmliteratur
von Delluc um 1920, Moussinac: „Panoramique du cinema“, Rudolf Arn-
heim: „Film als Kunst‘, Gottfried Müller: „Dramaturgie des Theaters und
des Films“, Rehlinger, Harms, Groll, Brusendorff, Waldekranz, Jacobs usw.,
wurden von Dr. Börge folgende sieben Punkte als eigene Thesen zur Dis-
kussion gestellt. Sie drehen sich alle um den Schauspieler, der ge-
meinsam für Theater und Film ist:
1. Der Filmschauspieler im Atelier hat nur einen einzigen Zuschauer:
die Kamera, die ungeheuer empfindlich ist.
2. Der Schauspieler des Theaters kann sich stärkere Gebärden erlauben
als der Filmschauspieler, gerade weil die Kamera ein weit besserer Beob-
achter ist als das menschliche Auge.
3. Der Theaterschauspieler, der sich auf einer großen Bühne bewegen
kann, hat viel mehr Raumempfinden als der Filmschauspieler. Im Film
muß die Kamera die ganze Zeit den Raum hineindichten. Der Theater-
schauspieler trägt den Raum in sich und um sich.
4. Der Kontakt mit dem Publikum fehlt im Film. Die unmittelbare
Wirkung des gesprochenen Wortes fällt weg. Und doch darf der Film-
schauspieler nie vergessen, daß die Kamera wie ein Mensch ist, wie ein
sehr sensibler Mensch. Der Theaterschauspieler lebt von der Wechsel-
beziehung mit dem lebendigen Publikum. Zwischen ihm und ihr gehen
geheime Strahlen aus. Der Filmschauspieler lebt von der geheimen Atmo-
sphäre der Kamera. Er muß Wechselbeziehung zu etwas Maschinellem und
nicht zu etwas Lebendigem haben.
5. Ihm ist nicht die Schauspielkunst sondern das Bild als Totalität
das Entscheidende. Das macht einen ungeheuren Unterschied zwischen
den beiden verwandten und doch verschiedenen Kunstarten, die doch den
Schauspieler gemeinsam haben.
6. Die Probenarbeit ist eine ganz andere im Film als im Theater.
Jede Szenenaufnahme im Film ist im Grunde genommen eine selbständige
Premiere. Es fordert eine gewaltige Konzentration des Filmschauspielers,
alle diese Einzelaufnahmen, die oft in umgekehrter Ordnung stattfinden,
zur synthetischen künstlerischen Einheit zu bringen.
7. Übrigens unterscheiden sich die Arbeiten, Ausdrucksmittel und
Leistungen des Filmschauspielers vom Theaterschauspieler in unendlich
vielen anderen Beziehungen. Zum Beispiel rein mimisch. Man denke an
die Nahbilder, die es im Theater gar nicht gibt, usw., usw.
Der Leiter der Theaterabteilung der Reichshochschule für Musik,
Prof. Dr. Hans Niederführ, brachte in seinem Kolloquium in
13 Vorlesungen, bzw. Übungsstunden über praktische Bühnen-
kunde zunächst grundsätzliche Auseinandersetzungen über Theater-
wissenschaft und Bühnenpraxis in ihrer Polarität und stellte die
Wichtigkeit und Notwendigkeit ihrer wechselseitigen Ergänzung dar.
Das Arbeitsgebiet der praktischen Bühnenkunde selbst wurde nach
dieser allgemeinen Einleitung sodann in drei Kapitel zu je vier Abschnitten geteilt.
Die drei Hauptstücke hießen: A. Personal, B. Einrichtung, C Arbeit.
Zum ersten Abschnitt gehören: 1. Darsteller, 2. Regisseur und Diri-
gent, 3. Leitung, 4. Bühnenpersonal.
Zum zweiten Abschnitt gehören: 1. Theaterbau, 2. Bühneneinrichtung,
3. Beleuchtung, 4. Fundus.
Zum dritten Abschnitt gehören: 1. Inszenierung, 2. Betrieb, 3. Ar-
beitsplanung, 4. Soziales Korporationswesen.
Die Durchbesprechung des Stoffes erfolgte jedoch nicht abschnitt-
weise, sondern zunächst im allgemeinen Querschnitt an Hand der genauen
und ausführlichen Schilderung einer großen Schauspielinszenierung, die
alle weiteren Übungsstunden des Semesters ausfüllte.
Ergänzt wurden diese Darlegungen durch praktische Beispiele. Es
wurde versucht, die Hörer an der Entscheidung einer Übungsinszenierung
der Theaterabteilung der Reichshochschule für Musik teilnehmen zu lassen.
Hiefür wurde Carlo Goldonis „La vedova scaltra“ (Die kluge Witwe)
gewählt. Die Hörerschaft hatte Gelegenheit, die Entstehung der drama-
tischen Bearbeitung und des Bühnenbildes kennen zu lernen, um sodann
in Gruppen auch bei den einzelnen Proben teilzunehmen. Die Inszenierung
ist noch nicht abgeschlossen. Die letzten Proben werden während der
Semesterferien zugängig sein.
Praktische Vorführungen bühnentechnischer Einrichtungen und Hilfs-
mittel im
Schönbrunner Schloßtheater bildeten eine weitere Ergänzung
und Abrundung.
Ganz besonderen Anklang fand eine Neueinrichtung dieses
Semesters, die „Ringvorlesung“. Sie wurde diesmal für künf-
tige Kunstbetrachter abgehalten, wird im nächsten Semester für
künftige Dramaturgen und im übernächsten für künftige Regis-
seure veranstaltet. Die diesmalige Ringvorlesung führte an alle
Wiener Hochschulen, weil alle sich mit dem Theater befassen, und
gewährte Einblick in alle die Werkstätten der am theatralischen
Prozeß mitwirkenden, und zwar immer im Hinblick auf das, was
der Kunstbetrachter davon wissen muß. Sie begann am Zentral-
institut selbst mit einer Einführung in das Wesen und die Aufgaben
der Theaterkritik durch Prof. Kindermann, an die sich prak-
tische Übungen der Teilnehmer und Diskussionen über die vor-
getragenen Beispiele anschlossen. Sodann ging es an die Akademie
der bildenden Künste, wo Prof. Pirchan in die Werkstatt des
Bühnenbildners, Doz. Lutz in Theaterbau von Vergangenheit und
Gegenwart einführten, sowie Prof. Gregor über die Kunstbetrach-
tung des Bühnenbildes sprach. An der Technischen Hochschule
führte Prof. Grom-Rottmayer in das Wesen der Bühnen-
maschinerie und in die Geschichte der Bühnenbeleuchtung ein. An
der Hochschule für angewandte Kunst erörterte Prof. Nieder-
moser Fragen der Kostümkunde im Zusammenhang mit der
Bühnenbildnerei. Doz. Börge sprach über die Kunstbetrachtung des
Films und Prof. Niederführ, der Leiter der Schauspielschule
des Burgtheaters, die der Reichshochschule für Musik eingegliedert
ist, erläuterte Geschichte und Prinzipien der Schauspielererziehung.
Um den fernbetreuten Kameraden ein möglichst lebhaftes Bild von
dieser überaus fruchtbaren und vielseitigen Vortragsreihe – die
meisten Vorträge waren von Bild- und Modelldemonstrationen be-
gleitet – zu geben, fügen wir am Schluß noch den anschaulichen
Erlebnisbericht einer Kameradin bei.
Im Wiener Kulturleben haben die großen Sonderveran-
staltungen des Zentralinstituts, die während des Semesterlaufs
einmal im Monat im Auditorium maximum der Universität statt-
finden, schon einen besonderen Platz und Rang erworben. Sie
wurden in diesem Wintersemester erfolgreich, d. h. jedesmal unter
Teilnahme von 600 bis 700 Besuchern fortgesetzt. Wie schon im
zweiten Rundbrief berichtet, sprach da im November Staatsschau-
spieler Friedrich Kayssler vom Staatlichen Schauspielhaus Berlin
über das Wesen der Schauspielkunst. Wir lassen hier
einen kurzen Ausschnitt aus diesem Vortrag folgen:
Auch in der tiefsten Sympathie und Bewunderung dem Theater
gegenüber schwingt seit jeher unwillkürlich unbewußt eine andere Emp-
findung mit, als geschähe da etwas, was sich auf eine gewisse Weise vor-
drängt, eben weil es sich selbst zur Darstellung bringt. Diese Empfindung
ist mit keinem Vorwurf belastet, sie stellt nur eine Tatsache fest: hier
wird zur Schau gespielt. Es liegt etwas Anziehendes und zugleich Be-
ängstigendes darin, ein geheimnisvoller Reiz und etwas, was Scheu erregt.
Beide Empfindungen bestehen zu Recht und haben ihren tiefen Grund im
Laien wie im Künstler. Jeder weiß natürlich, daß es sich hier nicht um
Eitelkeit handelt, daß vielmehr Eitelkeit oder Sichvordrängenwollen mit
Schauspielkunst nur gerade ebensoviel oder ebensowenig zu tun hat wie
mit jeder anderen menschlichen Betätigung, insoweit sie eben eine all-
gemein mögliche menschliche Schwäche ist. Aber jeder fühlt, auch der
Unwissendste, daß er hier vor einem Geheimnis steht, vor einem mysti-
schen Vorgang der Verwandlung. Und jeder fühlt auch, daß der Weg zu
dieser Verwandlung nur durch die Tür der Selbstdarbietung des Menschen
führt. Es ist wirklich eine Tür, durch die dieser Weg führt; denn, um
die Verwandlung zu erleben, ist es nötig, daß der Mensch erst aus sich
herausgeht, um in etwas anderes hineinzugelangen: in den Traum des
künstlerischen Geschehens, hinüber in jene andere Lebensform, die der
unseres täglichen Lebens mindestens ebenbürtig, oft aber weit überlegen
ist, weil der Mensch hier in seiner neuen, verwandelten, geistigen Gestalt
auf der Ebene des reinen geistigen Lebens tätig ist, und dort mit den Ideen
selbst, mit den Wahrheiten und geistigen Möglichkeiten selbst in unmittel-
baren Verkehr tritt.
Wenn ich hier sage: der Mensch, so meine ich nicht den Schauspieler,
sondern Darsteller und Zuhörer oder Zuschauer zusammen. Der Darsteller
ist der, der den Weg wissen muß und vorangeht, aus sich heraus, hinein
in das geistige Reich des Traumes. Ihm folgt der Zuhörer, der wirklich
hört, der Zuschauer, der wirklich schaut. Eine und dieselbe Kraft muß
sie beide in Bewegung setzen, wenn sie aus sich heraus und hinüber
kommen wollen: die Kraft der Hingabe. Nur kraft der Hingabe können
sie sich drüben alle zusammenfinden zu jener seelischen Harmonie und
Einheit, die einzig und allein Zweck und Ziel aller Kunst ist. Dann sagen
die Menschen, es war eine wirklich gute Vorstellung. Ob es ein Erfolg
war, steht auf einem ganz anderen Blatt; zu einem Erfolg gehört eine
Entscheidung, und Entscheidungen treffen können Menschen nicht, so-
lange sie unter der Kraft der Hingabe stehen. Erst wenn die Hingabe auf-
hört und die Gehirne wieder in Tätigkeit kommen, werden solche Ent-
scheidungen formuliert. Dann ist das eigentliche künstlerische Erlebnis
vorbei.
Wir sind uns klar darüber, daß erst dann, wenn eine Einheit sich
bildet, eine wahre Einheit in einem einzigen gemeinsamen Gefühl, eine
Einheit der Menschen untereinander, innerhalb deren es keine Unter-
scheidungen wie Darsteller, Zuhörer, Zuschauer mehr gibt, daß erst dann
wahrhaft von Kunst gesprochen werden kann. An einem solchen Ge-
danken versuche ich selbst mir klarzuwerden, wenn ich verstehen will, daß
Kunst an und für sich kein Ziel ist, sondern erst die Kraft der Einheit,
die von ihr ausgeht. Was tut der jüngste Anfänger, wenn er in seiner
Studierkammer seine erste künstlerische Handlung beginnen will: er kon-
zentriert sich, er sammelt sich zu sich selbst, er sammelt seinen innersten
Menschen auf einen allerinnersten unsichtbaren Kernpunkt zusammen zu
einer Kraft, für die er selbst keinen Namen weiß. Was tut ein Theater?
Es sammelt alle die allerinnersten Kernkräfte seiner Schauspieler auf den
mittelsten Kernpunkt der Dichtung. Was tut der einzelne Schauspieler
im Augenblick der tiefsten Konzentration? Er öffnet die winzige unsicht-
bare Tür nach innen und führt seine Zuhörer, die dem Willen zur Hingabe
folgen, mit hinein. Die Kunst verschwindet – und die Einheit ist da.
Hier stehen wir an der Quelle der Schauspielkunst. Leicht ist es, sich
von hier aus zurückzudenken in eine Zeit ihrer Uranfänge, wo aus einer
Mitte religiös versenkter Menschen irgend einer sich innerlich getrieben
fühlte, plötzlich aufzustehen, seinen Körper rhythmisch zu bewegen und
seinen Mund zu öffnen zu einer Sprache, die ihm selbst neu und fremd
schien und doch wieder auf eine geheimnisvolle Weise vertraut: denn er
wußte mit einemmal: sein Körper war jetzt Ausdruck für die innerste
Bewegung aller, sein Wort war jetzt Laut für das Unsagbare, das alle
bisher stumm in sich aufwachsen gefühlt hatten.
So war es. Anders kann es nicht angefangen haben, einmal vor un-
denklichen Zeiten. Damals freilich fanden sich die Menschen nur dann
zusammen, wenn sie das innere Bedürfnis dazu trieb. Heute ist es anders
geworden. Darum ist es aber gut und heilsam, sich hin und wieder einmal
zurückzudenken bis zu diesem Anfang. Wir wollen den Notwendigkeiten
der Entwicklung nicht unrecht tun, die aus jenen Uranfängen auf einem
endlosen Wege bis zu dem geführt hat, was wir heute Theater nennen.
Wir wissen, daß es Torheit ist, ins Primitive zurückzukriechen, weil das
Vielerlei verwirrend zu werden beginnt. Aber es ist heilsam und wunder-
kräftig, manchmal in tiefer Rückerinnerung einen ehrfürchtigen Trunk zu
tun aus jener schmucklosen reinen Quelle unserer Kunst. Dann verstehen
wir erst wieder ganz, daß sich im letzten Grunde bis heute nichts geändert
hat und daß sich immer und immer wieder dasselbe wiederholen muß,
wenn einmal – was nicht alle Tage geschehen kann – die Stunde für die
Kunst gekommen ist: die Stunde für die Menschen, im Innersten zuein-
ander zu finden.
Im Dezember nahm Prof. Pirchan, Leiter der Meisterklasse
für Bühnenbildnerei an der
Wiener Akademie der bildenden
Künste, das Wort zu einem in den Entwicklungsgang einführenden
Lichtbildervortrag „Die Künste des Bühnenbildes“. Das
„Neue Wiener Tagblatt“ berichtete darüber u. a.:
Es gibt noch keine Kunstgeschichte des Bühnenbildes. Vielleicht des-
halb, weil hier Kunst und Technik so eng verschwistert sind, ähnlich wie
beim Film, daß der Impuls zum Fortschritt jeweils viel stärker aus der
Mechanik kam, denn aus der Kunst. Prof. Emil Pirchan betitelte seinen
Vortrag im Zentralinstitut für Theaterwissenschaft bezeichnenderweise als
„Die Künste des Bühnenbildes“, nicht nur deswegen, weil der Bühnen-
bildner Maler, Architekt, Kostümkundler, Maskenbildner und noch man-
ches andere in einer Person vereinigen muß, sondern weil dem Plural
„Künste“ eine leichte Färbung der Täuschung, des Scheines innewohnt;
man könnte sogar sagen, die „Zauberkünste“ des Bühnenbildes, denn es
soll eine Scheinwirklichkeit vorgetäuscht werden, in der weder Raum noch
Materie ihrer tatsächlichen Beschaffenheit entsprechen. Der Bühnenbildner
muß also schöpferische Gestaltungskraft und technischen Erfindungsgeist
in sich vereinigen. Illustriert an zahlreichen Beispielen des Bühnenbildes,
gab Prof. Pirchan eine Geschichte der Kulissenbühne, die von der „Mei-
ningerei“ bis in die Gegenwart führte und mit der Vorführung moderner
bühnentechnischer Einrichtung schloß. Er streifte die Hauptphasen in die-
sem seltsamen Geschmackswechsel, der von der Andeutungsbühne bald
wieder zum andern Extrem durchbrach, einer weitgehend plastischen Ge-
staltung großer Räume, mit Riesenarchitekturen, dem Film entlehnt, die
in den Dekorationsmagazinen kaum mehr Platz finden konnten. Der Krieg
machte nun aus der Notwendigkeit eine Lehrmeisterin, so daß gerade
durch die Einschränkungen vielleicht ein neuer Stil im Bühnenbild vor-
bereitet wird. Die Täuschungskunst verzeichnet weitere Fortschritte, und
der Beleuchtung kommt durch die Erfindung der Lumogenfarben, die zum
Beispiel von Quarzdampflampen bestrahlt, einer wirkungsvollen transparen-
ten Wirkung fähig sind, immer größere Bedeutung zu.
Im Januar sprach der weit über Deutschland hinaus bekannte
Oberspielleiter der
Wiener Staatsoper
Oskar Fritz Schuh über
„Probleme der modernen Opernregie“. Aus dem viel-
diskutierten, sehr programmatisch gehaltenen Vortrag, der im Rah-
men der Schriften des Zentralinstituts im
Wilhelm-Frick-Verlag
(Wien) erscheinen wird, geben wir hier zur ersten Orientierung
einen kleinen Ausschnitt:
Allmählich hat sich doch die Meinung mehr und mehr durchgesetzt,
daß die Oper nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein theatralisches
Kunstwerk ist. Und zwar beginnt die neue Konzeption eigentlich so recht
bei Richard Wagner, der der erste inaugurierende Regisseur seiner eigenen
Werke ist. Deshalb ist auch das, was man Bayreuther Tradition nennt,
das, was sich am längsten und lebendigsten auf dem Theater bis in unsere
Gegenwart hinein erhalten hat. Das, was heute an Wagner-Darstellung
und Wagner-Inszenierung geleistet wird, geht in seinen besten Elementen
auf diese ersten Bayreuther Regietaten Wagners zurück. Im Werke Wag-
ners hat sich der Begriff des musikalischen Theaters zum ersten Male
wieder bestimmend eine längere Zeit durchgesetzt. Es gibt natürlich eine
Reihe von Opern, die ich die sogenannten Musizieropern nennen möchte,
bei denen es vorläufig noch genügt, wenn die Handlung zu einigen schönen
bildhaften Momenten zusammengefaßt wird und sich im übrigen das Spiel
locker und leicht abwickelt. Nicht zu dem Typ der Musizieroper möchte
ich das Werk von Händel rechnen. Obwohl hier scheinbar nur gesungen
und musiziert wird und alles auf musikalische Dinge abgestimmt zu sein
scheint, erwächst dem Inszenator eine wesentliche Funktion, ich möchte
fast sagen, eine geistige Funktion, dieser Oper ihre ursprüngliche spirituelle
Bedeutung wiederzugeben. Händel ist, wenn ich mich so gewagt aus-
drücken darf, der erste Expressionist des Theaters. Alles rollt gänzlich
unpsychologisch ab, jeder Auftretende dient der direkten Aussage über
sich, seine Absichten, seine Leiden und Freuden und die Zusammenstöße
zwischen den handelnden Personen vollziehen sich oft ganz primitiv und
simpel. Und trotzdem wird hinter allem eine geistige Ordnung sichtbar,
die wiederherzustellen nicht der Musik allein überlassen sein kann, son-
dern die aufzufinden das Werk des Regisseurs sein muß. Erst wenn es ihm
nämlich gelingt, diese scheinbar so starre Welt wie eine Gleichniswelt dar-
zustellen, dann wird der heutige Zuschauer eine Händel-Oper als ein Stück
lebendigen Theaters begreifen und nicht nur als eine Anhäufung von
wunderbaren Arien. Hier ist schon ein Beispiel, an dem gezeigt werden
kann, daß die nachschaffende Hand des Regisseurs dem Musikalischen die
theatralische Form an die Seite zu stellen hat.
Es braucht nicht gesagt zu werden, daß diese Pflege der Darstellung
in der Oper zu den wesentlichsten Aufgaben des Regisseurs zählt. Von
ihm müßte nicht nur die stilbildende Kraft einer Opernvorstellung aus-
gehen, sondern er wäre gleichzeitig dazu bestimmt, im Operndarsteller
jene schöpferischen, darstellerischen Fähigkeiten zu erwecken und zu för-
dern, die einer Opernaufführung neben allem musikalischen Glanz auch
noch das Bild einer Theatervorstellung geben. Die Regie ist dann am
besten, wenn nicht aus der Musik heraus gespielt wird, sondern wenn Musik
und Darstellung so zu einer Homogenität verschmelzen, wie im Schauspiel
Wort und Gebärde. Nichts verstimmt in der Oper mehr als die An-
häufung der szenischen Ausdrucksmittel. Gerade die sogenannten musi-
kalischen Regisseure trauen der Musik als solche zu wenig Wirkung zu.
Lange Passagen völliger Ruhe, einer Ruhe, die allerdings intensiv und
gespannt sein muß, werden von der Musik ohneweiters getragen. Und erst
dort, wo die musikalische Wirkung allein nicht mehr genügt, hätte das
Szenische einzusetzen. Hier hätte auch die Operndarstellung in ihre Rechte
zu treten. Immer wieder ist man erstaunt, wieviel Bebabungen gerade
auf darstellerischem Gebiet das Operntheater aufzuweisen hat. Diese
Begabungen sinnvoll zu entwickeln, ist eine der wesentlichen Aufgaben der
Regie. Diese Regie wird dann am besten arbeiten, wenn sie nicht mit
festgelegten, am Schreibtisch fixierten Vorstellungen an den darstellenden
Sänger herantritt, sondern in einer lebendigen Kommunikation mit den
ganz spezifischen Möglichkeiten des betreffenden Sängers arbeitet. Also
statt Starrheit Lockerung.
Aus dem musikalischen Schaffen der Gegenwart ergibt sich das deut-
liche Bestreben, die Oper wieder dort hinzuführen, wo sie eigentlich ihren
Ausgangspunkt genommen hat. Also das Gültige an die Stelle des Zufälligen
zu setzen und das überhöhte Gleichnis zum Gegenstand einer musik-
dramatischen Äußerung zu machen. Deshalb auch die Bevorzugung mytho-
logischer, vor allem aber antiker Stoffe. Ich glaube nicht, daß eine Gegen-
wart am musikdramatischen Schaffen ihrer Zeit vorübergehen kann, denn
immer war es so, daß nur von den neuen Werken her das Theater seine
Blutzufuhr bekommen hat.
Im Februar schließlich ergänzte Prof. Gregor, der Direktor
der Theatersammlung der
Wiener Nationalbibliothek, dieses Thema
durch seinen von musikalischen Beispielen begleiteten Lichtbilder-
vortrag "Probleme des Bühnenbildes der Oper".
Auch von diesem überaus anschaulichen und sehr persönlich gehal-
tenen Vortrag geben wir einen Teil wieder:
Ist die Musik der geheimnisvolle Urgrund des Dramas überhaupt, so
ist sie auch der Urgrund seiner letzten sichtbaren und greifbaren Gestalt
- seines Bühnenbildes. Es ist die Ansicht von Richard Strauß, daß jene
Verkörperungen der Musikdramen Wagners, die er selbst mit seinen
künstlerischen Freunden in Bayreuth vorgenommen hat, in mancher Hin-
sicht unübertrefflich waren, weil sie eben als letzte Erscheinungsform zu
seiner Schöpfung gehörten. Jene Bühnenbilder müssen wir als spät-
romantisch erkennen die Musik aber ist nicht an einen Zeitstil gebun-
den, sie ist ewig! Wir besitzen ein Recht, ja eine hohe künstlerische Pflicht,
auch im Falle Wagners auf neue Bühnenlösungen zu dringen. Dennoch
ist Strauß so weit gegangen, um einmal an Alfred Roller die Frage zu
richten, ob es denn möglich wäre, sich den Lösungen Wagners auch zeit-
gemäß anzunähern, ohne sklavisch zu imitieren und ohne historische
Kopien zu bieten. Roller hat erstaunlicherweise diese Frage bejaht, aber
die für ihn so charakteristische Einschränkung gebraucht: "Wenn Sie
Maler finden, die noch so gut und sauber malen können, wie es damals
die Regel war."
Die Schöpfung des Bühnenbildes an ewigen Beispielen des Musik-
dramas wird stets ausschließlich Amt des großen Künstlers bleiben. Wir
können sie historisch nachprüfen und beurteilen, wir können aber ebenso-
wenig Gesetze dafür aufstellen wie für jedes andere Gebiet der Kunst,
dessen Schöpfungen uns überraschen und hinreißen. Der große Künstler,
der sich ganz in Wagner vertieft, wird auch sicherlich ein Bühnenbild
Wagners finden, ohne die geschichtlichen Voraussetzungen zu kennen. Er
wird es, weil er dem gemeinsamen Urgrund aller Funktionen des Musik-
dramas, auch seiner bildlichen auf der Bühne, nahe ist. Auch ich hatte
das Glück, mich diesem schöpferischen Prinzip nahe zu fühlen - durch
meine drei gemeinsamen Arbeiten mit Meister Strauß, und ich möchte das
Paradoxon wagen: Nicht nur die Musik, auch das Bühnenbild ist von ihm
geschaffen. Ich denke an jene Stelle des "Friedenstag", jener Oper, die in
Wien nur ein einzigesmal erklang, und dies am 75. Geburtstag des Meisters
und in Anwesenheit des Führers. Es ist bekannt, daß die szenische Vor-
aussetzung des Stückes eine belagerte Zitadelle ist, deren heroische Insassen
eben im Begriff sind, die Festung und sich selbst in die Luft zu sprengen,
weil sie keinen anderen Ausweg sehen und nicht in die Hand des Feindes
fallen dürfen. Sie sind ahnungslos, daß der Friede schon ganz nahe ist -
er erreicht sie durch den Mund der Glocken, durch andere, menschliche
Boten, endlich durch das unabdämmbare Hereinströmen von Freund und
Feind, nunmehr wieder vereint. In diesem Augenblick habe ich die sze-
nische Bemerkung gewagt: "Die Mauern öffnen sich, der Turm versinkt.
Sonnige Helle dringt ein, es ist alles ein einziges wogendes Menschen-
meer." Ich forderte also eine völlige Auflösung des Bühnenbildes ins
Irreale, aber ich forderte sie keineswegs aus dramatischen, sondern aus
musikalischen Gründen, um für den überströmenden Schlußhymnus des
Werkes zum seelischen Raum auch den überweltlichen Bühnenraum zu
schaffen.
In der Tat sah ich bereits Lösungen, die es unternehmen, das Un-
mögliche möglich zu machen. Das Holzwerk eines Riesentors sprang auf,
und wie ein endloser Strom drang Licht und Helle, drangen frohe Men-
schen herein. Der ganze obere Teil des Turms löste sich, ging geradezu in
nichts auf, das Mauerwerk stellte sich als Podest heraus für einen über-
mächtigen Chor (Prof. Mahnke in Dresden). Wesentlich größer noch ist
die szenische Aufgabe, die der Schluß der bukolischen Oper "Daphne"
dem Bühnenkünstler stellt. Vor unsern Augen, der Sage getreu, soll
Daphne in den Lorbeer verwandelt werden. Diese Metamorphose ist nicht
nur der Dichtung, sie ist auch der Bühne nicht neu. Schon der hellenistisch-
römische Tänzer vermochte Daphne darzustellen, und er mimte den
Augenblick der Erstarrung so deutlich, daß man ihm die Verwandlung
angeblich glaubte. Auch das Barocktheater hat auf diesen Augenblick, um
den sich gegenwärtig die Bühnen wieder dankenswert bemühen, durchaus
nicht verzichtet, aber auch er, wie so vieles, darin das Barocktheater uns
Meister ist, war in jenem Kostüm bedeutend leichter auszuführen: Gold-
blätter, die wie Stickerei Korsage und Ärmel umliefen, konnten aufgestellt
werden und zeigten sich auf der anderen Seite grün! Eine äußerst ein-
fache, im Grund aber überzeugende Wirkung, denn sie ist ganz und gar
vom stärksten aller Theaterstile getragen. Sie muß auch bei voller Beleuch-
tung erfolgt sein, denn der Marquis, der im Ballett Ludwigs XIV. den
Apollo gab, nahm einmal seiner Daphne, einem Fräulein von Verpré,
einen Zweig ab und flocht sich eine Krone daraus.
Solche stilistische Erwägungen sind Richard Strauß ganz fremd. it
der Zielsicherheit des großen Dramatikers drängt er nach dem Unbeding-
ten, Endgültigen. Meine szenischen Bemerkungen steigern sich daher in
ihrer Kühnheit. Es wird dunkel, Daphne rafft sich auf und eilt in den
Hintergrund, plötzlich bleibt sie festgebannt. Dann, nach ihrem letzten
Sehnsuchtsruf an die geschwisterliche Natur: "Daphne unsichtbar, an
ihrer Stelle erhebt sich der Baum." Von hier ab gibt es nur "Stimme der
Daphne", einzelne Worte, schließlich nur Töne, die sich schon dem Blät-
terrauschen vermählen. ... Wieder soll das Unbeschreibliche getan sein.
Und diesmal scheint der Meister wirklich das Gefühl gehabt zu haben,
daß er ein wenig viel forderte, denn er schrieb an den Rand meines Text-
buches: "Der Bühnenbildner und -beleuchter muß sich tüchtig anstrengen."
Auch außerhalb dieser Sonderveranstaltungen gab es für die
Mitglieder des Zentralinstituts viel zu sehen und zu hören. So
waren sie eingeladen, an einem von der Gesellschaft für Wehr-
wissenschaften und Wehrpolitik im Rahmen eines Europa-Zyklus, in
dem sonst die Professoren v. Srbik, Nadler, Hassinger u. a. das
Wort ergriffen hatten, veranstalteten Vortrag von Prof. Kinder-
mann über "Die europäische Sendung des deutschen
Theaters" teilzunehmen. Dieser Vortrag, der über acht Jahr-
hunderte des Kräftespiels zwischen dem deutschen und europäischen
Theater hinleuchtete, wird im Druck erscheinen. Wir hoffen, ihn
einem der nächsten Rundbriefe beifügen zu können.
Weiters hatte das Zentralinstitut selbst den Senior der deut-
schen Theaterwissenschaft, Prof. Arthur Kutscher (München),
gebeten, im Auditorium maximum der
Wiener Universität über
"100 Jahre Faust auf der deutschen Bühne" zu spre-
chen, und es hatte den nun 78jährigen Dramatiker Max Halbe
eingeladen, im Kainzsaal des Zentralinstituts aus seinen auto-
biographischen Schriften zu lesen. Über die beiden, knapp auf-
einander folgenden Veranstaltungen berichtete die Wiener Ausgabe
des "Völkischen Beobachters":
Im Zentralinstitut für Theaterwissenschaft sprach Prof. Kutscher,
der Senior und Begründer der Theaterwissenschaft, über das Thema
"100 Jahre Faust auf der deutschen Bühne". Prof. Kutscher ließ (die Aus-
führungen waren von Lichtbildern begleitet) durch die verschiedentlichen
szenischen Darstellungen des Goetheschen "Faust", beginnend mit Hand-
zeichnungen des Dichters selbst bis zu Entwürfen unserer Tage, die Pro-
bleme der Regie und des Bühnenbildes überhaupt vorüberziehen und ord-
nete die so gewonnenen Eindrücke um entscheidende Brennpunkte in die
Theatergeschichte ein.
Max Halbe, der uns allen bekannte und liebgewordene Dichter, las
aus seinen autobiographischen Werken. Der Direktor des Zentralinstituts,
Univ.-Prof. Dr. Heinz Kindermann, umriß einleitend das Werk des Dich-
ters und stellte vor allem die in dem weichselländischen Boden verwurzel-
te Natur Halbes in den Vordergrund, die von hier aus weithin Kräfte
des alldeutschen Raumes gestalten konnte. Vor allem seien in den beiden
jüngsten Werken des Dichters "Scholle und Schicksal" wie "Jahrhundert-
wende" noch über die vollendete, altersreife Kunst der Selbstdarstellung
hinaus ein theatergeschichtlich bedeutsames Dokument geworden. Hier-
auf trug der Dichter aus den genannten Werken vor. Und so erstanden
die Zeiten der "Jugend" inmitten der Berliner Theaterkämpfe, der Freien
Volksbühne, des Residenztheaters, Namen wie Brahm, Laudenthal, Schleu-
ther klangen auf und gewannen Leben. Der zweite Teil schloß die Ur-
aufführung des "Stroms" im
Wiener Burgtheater ein und schilderte die
Bedeutung, die dieses Theater in Deutschland stets besaß. Beide Vorträge
wurden mit starkem Beifall aufgenommen.
Ganz besonders eindrucksvoll war der Vortrag des bekannten
Sprachforschers Prof. Trier (Münster) über "Die Anfänge
des Theaters im Lichte der Sprachwissenschaft",
über den der folgende Bericht Aufschluß gibt:
Als Gast des Zentralinstituts sprach am 18. Februar Prof. Dr. Jost
Trier (Univ. Münster) über die sprachwissenschaftlichen Ergebnisse
seiner Forschungsarbeit auf dem Gebiete theatralischer Ursprungsfragen.
Was verbindet den Ringelreihen der Kinder moderner Großstädte
mit dem Chor der attischen Tragödie? Gibt es einen gleichen Ausgangs-
punkt in beiden Gestaltungsformen und wo ist er anzusetzen?
Prof. Trier ging in seinem Vortrag von alten und neuen Wort-
prägungen theatralischer Erlebnisse aus und zeigte ihre Wurzel im uralten,
bäuerlichen und gemeinschaftsgetragenen Daseinskreis von Sippe und
politischer Genossenschaft. Das theatralische Geschehen steht dem Alltag
entnommen in einem selbstgeschaffenen Raum.
Das hegende Umtanzen als früheste theatralische Spielform findet
in vielen Worten Ausdruck, deren ursprüngliche Sinnbedeutung auf den
Zaun hinweisen, den dinglich greifbaren Zaun, der sich aus der im Ring
angetretenen Versammlung zusammenstellt.
Mag es sich um das altniederländische "scheren" (eine Rolle spielen)
handeln, das uns auch im Friesischen als "schar" (Zaun, Stütze), im Latei-
nischen als "scurra" (Spaßmacher), im Neuhochdeutschen als "Schar" von
Menschen entgegentritt und in seiner Sinnbedeutung scheinbar willkürlich
zu wechseln scheint zwischen Worten für Zaun, Stütze, Tanz, Hegung
und Gemeinschaft, oder um das Niederländische Wort "Kluecht", das als
"Klucht" im 15. und 16. Jahrhundert als führende Bezeichnung der Zwi-
schen- und Nachpossen der niederländischen Bühne galt und uns einen
analogen Sinnbedeutungswechsel vorführt, oder um weitere gleichgeordnete
Ausdrucksformen - immer wieder läßt sich der Stamm des Wortes mit
einem indogermanischen Wort für Zaunbedeutung oder gabelförmigem
Pfahl ansetzen. Ebenso wie bei diesen räumlich und zeitlich ferner liegen
den Worten, läßt sich aber das Gleiche feststellen bei unseren heute noch
lebenden Worten "Komödie" und "Mimus". In "comos" ist der hegende
Chor als Spielring nachweisbar, der bei kultischen Handlungen der Dio-
nysosfeste eine große Rolle spielte. "Comae" aber ist auch das Dorf und
bindet sich hier eng an Pflichten der Dienstleistung in der bäuerlichen
Gemeinschaft. Ein ähnlicher Nachweis läßt sich für "mimus" erbringen,
das im lateinischen "munire" eine grenzende Befestigung aufweist, in
"munus" die Steuer und obliegende Pflicht, in "meare" gehen und wandern
bedeutet. Auch diese heute noch lebenden Worte fußen als auf dem
Zaun als Sinnansatz.
Auch unser deutsches "Spiel" findet seinen gemeinschaftsbezeugenden
Beweis in "Kirchspiel" und ähnlichen Worten politischer Gruppenbezeich-
nungen. Das Musische steht eng neben dem Kultischen der Gemeinschaft,
wenn in der Schweiz "das" Spiel (Gruppe herumziehender Maskenspieler)
eingeladen wird, um die Kinder zu rügen.
Zum Schluß seiner Ausführung ging Prof. Trier von Problemen des
modernen Theaters aus, das Zuschaer und Spieler trennte, praktisch
durch die Verdunkelung des Zuschauerraums und Erleuchtung der Kasten-
bühne, geistig durch die strenge Trennung von Zuschauern und Spielenden.
Der hegende Ring wird um die moderne Kastenbühne leider nur
selten geschlossen, da das Theaterspiel betrachtet wird als Objekt der
Anschauung, nicht aber, wie es sein sollte, unter aktiver Teilnahme des
Publikums im Herzen eines jeden einzelnen erlebt, in geistigem Durch-
bruch zu einem gemeinschaftsgetragenen Kultakt des Theatralischen.
Nicht als Flucht eines einzelnen aus der Wirklichkeit ist uns Heutigen
das Theater Bedürfnis, sondern zur Heilung und Wahrung, zur Rettung
der Gemeinschaft.
Die grundlegenden Neuerkenntnisse dieser sprachwissenschaftlichen
Arbeit werden sicherlich dem praktischen Theater zugute kommen und
Anregung geben, Traditionen zu halten und neue Wege zu suchen, um
der Nation das Theater als Kraftquell und Bindeglied zu erhalten.
Auch die unter der Leitung des Kameraden Ulrich stehende
Fachschaft für Theaterwissenschaft hat diesmal begonnen, eine Reihe
erfolgreicher Veranstaltungen durchzuführen. So sprach in ihrem
Rahmen der Schriftsteller Ernst Wurm über "Heinrich
George und Gustaf Gründgens". Dr. Otto Horny be-
richtete darüber in der Wiener Ausgabe des "Völkischen Beob-
achters":
Eine reiche Theatererfahrung und der von eigener dichterischer In-
tuition gelenkte Blick befähigen Wurm, allen charakteristischen Schat-
tierungen und den feinsten Strömungen des Seelischen, die das Spiel
unserer großen Darsteller formen, in der Schauspielerpersönlichkeit nach-
zuspüren und durch die Kraft des schöpferischen Wortes anschaulich zu
machen. So entstand vor den Zuhörern eines Vortrages, den Ernst Wurm
im Zentralinstitut für Theaterwissenschaft über Heinrich George und
Gustaf Gründgens hielt, das plastische Bild einer darstellerischen Gegen-
sätzlichkeit, die Wurm durch die Begriffe Körper und Intellekt kenn-
zeichnete: auf der einen Seite die erdgebundene, vitale, erruptive Schau-
spielernatur Georges, auf der anderen das von einer scharf profilierten
Geistigkeit bestimmte, einer mathematisch-musikalischen Rhythmik ent-
springende Darstellungsvermögen Gustaf Gründgens'. Das Gemeinsame an
diesen zwei hervorragenden Vertretern deutscher Schauspielkunst sieht
Wurm in der beiden geschenkten Gabe der Faszination, die sie zum
belebenden, mitreißenden Mittelpunkt der Aufführungen macht, in denen
sie mitwirken, da George und Gründgens ihre ganze Persönlichkeit in den
Prozeß der darstellenden Kunst stellen; Leistungen, die kaum einen Leer-
lauf aufweisen und, so verschieden auch Leibliches und Geistiges bei
ihnen ist, in steter Anverwandlung, Anspannung und Erhöhung ihres
Talents um die letzte und höchste Wahrheit im Künstlerischen ringen.
Wurms lebendige und eindrucksvolle Darstellung wurde mit dankbarem
Beifall aufgenommen.
Ein ganz besonderes Erlebnis war eine im Saal des Studenten-
werks von der Fachschaft durchgeführte Veranstaltung, bei der die
von Bayreuth und der
Wiener Staatsoper her berühmte Kammer-
sängerin Prof. Anna Bahr-Mildenburg über "Musikali-
sche Darstellungskunst von Gluck bis Richard
Strauß" sprach und diese Darlegungen mit einer Fülle zum Teil
selbst vorgeführter, zum Teil von ihren Schülern (u. a. Dagmar
Schmedes) vorgesungenen und vorgespielten Opernbeispielen unter
Beweis stellte. Die "Wiener Neuesten Nachrichten" gaben folgen-
den Stimmungsbericht:
Es ist nicht leicht, jungen Menschen von heute klarzumachen, was
die Mildenburg uns Älteren gewesen ist. Mangels eines Parallel-
falles in der Gegenwart muß man sich darauf beschränken, ihnen zu er-
klären, daß sie die größte Singschauspielerin der deutschen Opernbühne
in den letzten 50 Jahren gewesen ist. Eine Ahnung von der Größe und
Bedeutung dieser einmaligen Frau erhält aber der junge Mensch auch
heute, wenn er sie als Lehrmeisterin am Werke sieht. Wie gern geht sie
unter die jungen Menschen, um ihnen aus dem überreichen Schatz ihres
Wissens und ihrer Erfahrung einiges mitzuteilen!
Ein schöner Abend vereinigte am Samstag die Meisterin mit Hörern
der
Wiener Universität. "Musikdramatische Darstellung von Gluck bis
Richard Strauß" war ihr Vortrag betitelt. Ein Vortrag der Mildenburg
enthält nur ganz wenige theoretische Erklärungen, er führt sofort mitten
in das lebendige Theater hinein. An praktischen Beispielen in großer
Zahl erläutert sie ihre Lehrmethode, die, auf eine knappe Formel gebracht,
heißt: "Sie müssen die Musik sehen!" Echte dramatische Musik enthält
nicht einen überflüssigen Ton, jede Note hat ihre musikdramatische Auf-
gabe und verlangt vom Darsteller sofort die entsprechende Gebärde oder
Miene.
Wie leicht sieht dies alles aus, wenn die Mildenburg es vorführt,
gleich ob sie nun ihre großen Wagner-Gestalten, die Brünhilde, Isolde,
17
Elsa, Elisabeth, aber auch den Wotan, verkörpert, oder die Santuzza,
Elektra, Iphigenie, den Tamino oder den Max aus dem "Freischütz".
Immer erschließt sie eine Gestalt restlos und bis auf den Grund. Jubel-
stürme, die immer wieder um Zugaben baten, umbrausten die Meisterin,
die, ihrer Jahre spottend, immer wieder Neues zu geben wußte. Junge
Künstler aus der Darstellungsklasse der Mildenburg unterstützten sie auf
das beste. am Flügel wirkte verdienstlich Kapellmeister Kubanek. Es
war ein schöner, beglückender Abend!
Ein Vortrag des Schriftstellers Dr. Handl über Kainz schließt
diese Reihe ab.
Zum erstenmal in diesem Semester war es den Mitgliedern des
Zentralinstituts vergönnt, an einigen Proben des Burgtheaters und
des Josefstädter Theaters teilzunehmen. So machten sie in Anwesen-
heit des Dichters die Hauptprobe zur Uraufführung von Gerhart
Hauptmanns "Iphigenie in Aulis" im Burgtheater mit, wohn-
ten gemeinsam einer Aufführung der am Burgtheater uraufgeführ-
ten Tragödie von Max Mell "Der Nibelunge Not" bei und
waren Zeuge der Generalprobe von Brauns Komödie "Die große
Kurve" im Josefstädter Theater.
Auch Veranstaltungen der Wiener Hebbel-Gesellschaft, so eine
Lesung Heinz Hilperts aus Hebbels Lyrik und Tagebüchern
im zauberhaften Eroica-Saal des Palais Lobkowitz (jenem Saal, in
dem Beethovens "Eroica" zum erstenmal erklungen war) und eine
überaus geglückte, szenisch ausgestaltete und musikalisch (Schu-
mann) umrahmte Rezitationsaufführung von Hebbels recht wenig
bekanntem Drama "Michel Angelo" im
Schönbrunner Schloß-
theater (durchgeführt von der Schauspielschule des Burgtheaters,
Leitung Burgschauspieler Volters, der selbst die Michel-Angelo-
Partie übernommen hatte) waren den Mitgliedern des Zentral-
instituts zugänglich gemacht worden.
Um die Ergebnisse der Seminarübungen noch besonders zu
stützen, wurde im Schreyvogel-Saal des Zentralinstituts eine neue,
zugleich auch schon für das Sommersemester gedachte Ausstel-
lung eingerichtet. Was da an rund 30 Bühnenbildmodellen und
zahlreichen Bildwerken, Dokumenten u. a. zu sehen ist, wollen wir
im nächsten Rundbrief genauer schildern.
Im Baron-Berger-Zimmer des Zentralinstituts ist die erste
theatergeschichtliche Dokumentar-Plastik des Bildhauers
Kauer aufgestellt worden. Es handelt sich um eine nach neuem
Verfahren hergestellte, geradezu atmend getreue Lebendplastik des
Schauspielers Wiemann in der Rolle des Empedokles. Eine
Reihe weiterer derartiger Lebendplastiken sind nun in Auftrag ge-
geben, vielfach auch zwei Darsteller in der gleichen Rolle, etwa
Tressler (Burgtheater) und Köck (Exlbühne) in der Rolle des
alten Grutz in Schönherrs "Erde" usf. Noch nach hundert Jahren
werden nun die Theaterwissenschaftler sagen können, wie die Maske
des betreffenden Schauspielers in dieser Rolle ausgesehen hat. Die
Dokumentarplastiken sind eine wichtige Ergänzung der Photo-
graphie.
Von weiteren Neuerwerbungen wären wieder große Bücher-
bestände, viele Bilder, auch wichtige Farbaufnahmen der Berliner
und Wiener Aufführungen, viele Theaterzettel und zwei wichtige,
uns anvertraute Schauspieler-Tagebücher der entscheidungsreichen
Jahre 1809 und 1810 zu erwähnen. Das "Theater-Archiv
Leuschke", diese uns überantwortete Sammlung von 60.000
Theaterkritiken und Schauspielerbiographien, wurde nun von Fräu-
lein Dr. Zirnig chronologisch geordnet. Schon stehen all die
stolzen schwarzen Pappkartons in Reih und Glied da und bald schon
beginnt unter der Leitung von Fräulein Dr. Zirnig die Arbeit an
jener Karthotek von einer halben Million Schlagworten, die dieses
Archiv zu einem wahren Segen machen wird.
Auch die Forschungsarbeiten des Zentralinstituts sind gut voran-
gekommen. Schon in wenigen Wochen wird das Verzeichnis von
2500 Stichworten für das Reallexikon der Theaterwissen-
schaft an alle Mitarbeiter versandt werden. Am "Handbuch
der Theaterwissenschaft" wird schon von einer Reihe
erster Forscher sehr eifrig gearbeitet. Der zweite Band der "The-
atergeschichte des deutschen Volkes" ist schon im
Umbruch. Das Manuskript des ersten Bandes ist im Entstehen. In
der Reihe "Theatergeschichtliche Forschungen"
wurden mancherlei neue Arbeiten aufgenommen, über deren Er-
scheinungstermin und Themen im nächsten Rundbrief berichtet wer-
den wird. Auch eine eigene Publikationsform speziell für Euch,
fernbetreute Kameraden, ist in Vorbereitung. Wir wollen darüber
aber erst etwas Näheres sagen, bis die ersten Exemplare vor uns
liegen. Indes ist Prof. Kindermanns Arbeit "Hölderlin und
das deutsche Theater" in einer Schriftenreihe des Zentral-
instituts im Verlag Frick (Wien) erschienen. Dank einer Stiftung
des Fernbetreuungsreferats unserer
Wiener Universität (Prof. Mei-
ster) können wir Euch ein Exemplar dieses Büchleins zugleich mit
diesem Rundbrief senden. Dies geschieht nicht nur, um Euch die
Lektüre dieser Arbeit zu ermöglichen, sondern um Euch auch die
Unterlagen für eine neue Aufgabe zu bieten. Da Ihr früh schon
lernen müßt, durch Bildinterpretation Eure theaterwissenschaftliche
Beobachtungsfähigkeit zu schulen, haben wir dem Buch eine Auf-
gabe beigefügt, die Ihr von einigen Bildbeigaben aus zu lösen ver-
suchen sollt. Schickt uns dann, bitte, Eure Ausarbeitungen, damit
wir dazu Stellung nehmen und Euch zu weiteren Beobachtungen
anleiten können.
Unser Zentralinstitut ist indes schon in ganz Europa bekannt
geworden. Es vergeht kein Tag ohne zahlreiche Besuche von
Theaterwissenschaftlern, Bühnenkünstlern und Studenten aus ganz
Deutschland, aber auch aus zahlreichen befreundeten Nationen. So
hatten wir in der letzten Zeit Besuche aus Ungarn, der Slowakei,
Kroatien, Griechenland, Bulgarien, Dänemark, Finnland, der
Schweiz usf.
Zu unserer großen Freude besichtigte Reichsminister Rust vor
einiger Zeit das Zentralinstitut sehr eingehend. Auch Ministerialrat
Dr. Frey, unser zuständiger Referent im Reichserziehungsmini-
sterium, hat das Institut schon inspiziert. Viele bedeutende Bühnen-
künstler, darunter auch Paula Wessely und Friedrich Kayssler, waren
bei uns. Prof. Kutscher (München), Prof. de Boor (Zürich), Dr. Max
Halbe sind zu uns gekommen - um nur einige wenige von all den
täglich hier Vorsprechenden zu nennen.
Gemäß dem anschwellenden Arbeitsbereich ist auch der Kreis
der ständig Mitarbeitenden gewachsen. In die Reihe der wissen-
schaftlichen Hilfskräfte trat neben unseren bisherigen bewährten
Assistentinnen Frl. Dietrich und Frl. Schiffer noch die schon
erwähnte Verwalterin des
Leuschke-Archivs
Frl. Dr. Zirnig. Frl.
Architekt Beck betreut nach wie vor die Bühnenbildmodelle.
Fr. Dr. Eisner arbeitet zusammen mit mehreren Studentinnen an
der Katalogisierung der täglich aus ganz Europa neu einlaufenden
Zeitungsausschnitte über Theaterereignisse. Frl. Meyer leitet die
Arbeiten am Schlagwortkatalog Gräfin Hoyos die Arbeiten am
Personalkatalog unserer immer größeren Bücherei (in einigen Wo-
chen wird ein sehr großer dritter Bibliothekssaal des Instituts
eröffnet). Frl. Roth betreut die Bilderkartei. Das tüchtige Frl.
Bramberger besorgt all unsere zahlreichen Schreibarbeiten und
unser braver Heizer Kummerer sorgt dafür, daß unsere schönen
weißen Kachelöfen immer hübsch warm und die festlich hohen
Räume auch im Winter gemütlich bleiben. So, nun kennt ihr uns alle.
Wir brauchen sicher nicht hinzuzufügen, daß am Wiener
Zen-
tralinstitut auch die Geselligkeit zu ihrem Recht kommt. Auch sie
freilich wird mit der Freude an der theatralischen Welt verbunden.
Bei unserem Weihnachtsfest in den Bauernstuben des Studetenwerks
wurden gleich drei Einakter aufgeführt und eine der Kameradinnen,
Hilde Weinberger, trug meisterhaft deutsche Balladen vor. Nun
steht das Schlußfest bevor und wir sind schon alle gespannt, was
diesmal der "große Rat" uns für künstlerische Genüsse bieten wird.
Immer aber, wenn wir beisammen sind, wandern unsere Gedanken
und unsere innigen Wünsche zu Euch allen hinaus. So senden wir
alle Euch an der Wende von Winter und Frühling unsere herz-
lichsten Grüße. Die Dozenten des Zentralinstituts
Prof. Dr. Kinder-
mann, Doz. Dr. Börge (seiner Herkunft nach Däne) und Prof. Dr.
Niederführ, aber auch die Assistentinnen, alle sonstigen Mitarbeiter
und alle die studentischen Mitglieder des Zentralinstituts denken in
diesen Tagen sehr an Euch. Wir alle wünschen Euch, damit aber
all unseren Tapferen draußen, all den Tapferen daheim und unse-
rem ganzen, großdeutschen Vaterland, daß die bald schon wärmende
Frühjahrssonne die große, endgültige Wende bringe!
an der Wiener Universität Prof. Dr. HEINZ KINDERMANN.
Ein kleiner zusammenfassender Bericht soll Ihnen allen, die
Sie in diesem Semester nicht in Wien waren, von einer schönen und
interessanten Einrichtung des Zentralinstituts erzählen: von der
Ringvorlesung.
"Ringvorlesung?" werden Sie fragen, "was heißt das?" Ja, was
heißt das? Es handelt sich dabei nicht um eine einzige Vor-
lesung, sondern um eine ganze Vorlesungsreihe, um einen Zyklus
von Vorlesungen. Der Ring ging aus vom Zentralinstitut und führte
uns über zehn Stationen wieder zum Institut zurück: Wir waren
dreimal in der Akademie der bildenden Künste und hörten dort
die Professoren Pirchan, Lutz und Gregor, zweimal kamen wir in
das Atelier von Prof. Grom-Rottmayer in der Technischen Hoch-
schule, einmal durften wir in die Hochschule für angewandte Kunst
zu Prof. Niedermoser kommen und bei uns im Institut hörten wir
Herrn Prof. Kindermann, Dr. Börge und Prof. Niederführ. An den
Namen sehen Sie schon, daß sich die Vorlesungen natürlich immer
um Fragen des Theaters drehten.
Die Ringvorlesung hatte den Zweck, uns einen Einblick zu ge-
währen in die praktische und künstlerische Arbeit der Schüler der
genannten Professoren, damit wir Wissenschaftler auch den Zwei-
gen des Theaterbetriebes, denen manche von uns vielleicht ferner
stehen, näherkommen. Daraus soll sich eine enge Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen Instituten ergeben: Zwischen den The-
aterwissenschaftlern, den Bühnengestaltern, den Architekten und
Ingenieuren, den Kostümschöpfern, den Filmleuten und den Schau-
spielern.
Die erste Ringvorlesung fand statt im Kainz-Raum des Zentral-
instituts, wo Herr Prof. Kindermann über Kunstbetrach-
tung sprach. Viele aus unserem Kreise wollen sicher diesen Beruf
ergreifen, und so war Herrn Prof. Kindermanns Vortrag von be-
sonderer Wichtigkeit. Den sog. Kritiker nennen wir heute lieber
Kunstbetrachter, weil das Wort Kritik immer gleich eine verneinende
Bedeutung hat. Eine Betrachtung sollen die Aufsätze des "Kri-
tikers" sein, was jedoch nicht ausschließt, daß das betreffende Kunst-
werk auf seinen Wert hin geprüft werden soll. Aber der Kunst-
betrachter muß immer daran denken, daß es von dem, was er sagt
(und wie er es sagt), abhängen kann, ob das Theater leer oder
voll sein wird. Er darf ein Stück nie so streng verwerfen, daß er
die Riesenarbeit aller an der Ausführung Beteiligten um ihren Preis
betrügt. Er soll alles zu würdigen wissen, und wenn er tadelt, muß
er in der Lage sein, Hinweise dafür geben zu können, wie Fehler
in Zukunft vermieden werden können. Der Kunstbetrachter trägt
somit eine große Verantwortung und muß über ein umfassendes
Wissen verfügen. An praktischen Beispielen führte uns Prof. Kin-
dermann vor, was eine gute und was eine schlechte Kunstbetrachtung
sei und stellte uns dann die Aufgabe, bis zur nächsten Ringvorlesung
selber einmal zu versuchen, eine Theaterkritik zu schreiben.
Wir hatten kurz vorher zum größten Teil die Hauptprobe von
Gerhard Hauptmanns neuem Drama "Iphigenie in Aulis" im Burg-
theater gesehen, und so hörten wir darüber in der nächsten Vor-
lesung zwei Betrachtungen. Es war sehr interessant, und es ent-
spann sich eine wilde Diskussion, denn die Ansichten der beiden
Schreiber waren äußerst gegensätzlich. Der eine pries in hohen, fast
pathetischen Worten den Dichter, das Stück und die Inszenierung,
während der andere, eine Kollegin, nicht mit allem einverstanden
zu sein schien und das sehr lebhaft, aber wohl etwas unbedenklich
zum Ausdruck brachte. Als sich die erregten Geister wieder beruhigt
hatten, kamen wir zu dem Schluß, daß beide vorgelesenen Kritiken
noch keinen Idealfall darstellten und daß der Weg zum Kunst-
betrachter ein ziemlich weiter sei.
Zur nächsten Ringvorlesung fanden wir uns im Anatomiesaal
der Akademie der bildenden Künste zusammen, um Prof. Pirchan
zu hören. Er sprach viel über die Künste des Bühnenbildes
und erzählte sehr viel von der Arbeit des Bühnenbildners und
aller Künstler und Handwerker, die an der Entstehung des Bühnen-
bildes beteiligt sind. Mit Lichtbildern aus den Werkstätten wußte
er seine Ausführungen sehr anschaulich zu gestalten, und er zeigte
uns zum Schluß auch noch eine Anzahl von Szenenentwürfen. Es
wurde uns klar, welch einen großen und vielseitigen Arbeitsprozeß
die Herstellung der "Dekoration" darstellt, und daß es daher un-
bedingt erforderlich ist, daß sich der Regisseur und der Bühnen-
bildner schon von Anfang an über die Art der ganzen Inszenierung
einig sind und daß sie im besten Einverständnis miteinander arbei-
ten müssen.
Am Montag darauf folgte eine Vorlesung des Doz. Lutz über
Theaterbau. Er gab uns in zwei Stunden einen großen histori-
schen Überblick über die Theaterbauweise von der griechischen An-
tike an über die Römer zum europäischen Theater des Mittelalters,
der Renaissance und des Barocks bis zu unserer heutigen Theater-
form, ja, er wies sogar in die Zukunft hinein. Mit kurzen Strichen
zeichnete er die jeweils besprochene Form an die Tafel, und wir
hatten zum Schluß eine großartige Zusammenstellung vor uns: den
halbrunden Bau der Griechen und Römer, wo erst der Tempel,
dann die eigenst dafür ausgerichtete Spielwand den Hintergrund
bildeten; daneben die aus derselben Geistesart erstandene (später
bewußt nachgebildete) Form des romanischen Theaters des Mittel-
alters und der Renaissance, die flächige Simultanbühne; im
Gegensatz dazu die räumliche Simultanbühne des deutschen und
englischen Mittelalters und schließlich die aus dem romanischen
Theater hervorgegangene sukzessive Barockbühne, die zur sogenann-
ten "Guckkastenbühne" wurde, welche wir heute noch haben. -
"Heraus aus dem Guckkasten!", das ist die Parole der Zukunft; man
will wieder eine Raumbühne einführen. Die Vorschläge, die bis
jetzt dafür gemacht worden sind, dürften aber wohl kaum befrie-
digend sein.
Die letzte Vorlesung in der Akademie der bildenden Künste
hielt Prof. Gregor. Er sprach über den Stil des Bühnen-
bildes. Die vornehmste Aufgabe des Bühnenbildners (den man
besser Bühnengestalter nennt, weil sein Werk ja kein Bild, eher
ein Gebilde, eine Raumgestaltung ist) wie auch des Regisseurs ist
es, sich in den Dienst des Dichters oder Komponisten zu stellen.
Das Wesentliche muß hervorgehoben, das Nebensächliche unter-
drückt oder weggelassen werden. Trotzdem gibt es zwei Grundstile
für den Bühnengestalter: den illusionistischen und den symbolisti-
schen. Wie Prof. Gregor mit Lichtbildern an Beispielen von Wagner-
Inszenierungen bewies, kann man bei beiden ein Zuviel des Guten
tun: entweder sich in der naturalistischen Wiedergabe von allen
Einzelheiten verlieren, oder die Formen so groß und "wesentlich"
sehen, daß der Zuschauer in beiden Fällen nicht weiß, was das
Ganze zu bedeuten hat. Jedoch die beiden Grundstile bestehen und
haben heute beide ihre Berechtigung. Der Bühnenbildner muß sich
nur davor hüten, sie zu vermischen. An Beispielen von Roller, Sie-
vert und Gliese zeigte uns Prof. Gregor dann gelungene oder bei-
nahe gelungene Entwürfe.
Die beiden nächsten Male pilgerten wir dann zu Prof. Grom-
Rottmayer in die Technische Hochschule, wo wir etwas über
Theatermaschinerie hörten. Nach einer kleinen geschicht-
lichen Darlegung zeigte uns der Professor an Hand von Lichtbildern
und Modellen die technischen Einrichtungen eines modernen Thea-
ters und versuchte sie uns, so gute es eben theoretisch möglich ist,
zu erklären. Es wurde uns aber versprochen, daß wir unter seiner
Führung einmal einer Aufführung des Burgtheaters hinter der
Bühne beiwohnen sollten.
Eine ganz besonders schöne Vorlesung hörten wir in der Reichs-
hochschule für angewandte Kunst bei Herrn Prof. Niedermoser,
der uns über das Theaterkostüm erzählte. Er umriß kurz die
Aufgaben des Kostüms: Dieses sei nicht in erster Linie für den
Zuschauer da, sondern für den Schauspieler, dem es eine Hilfe sein
soll bei dem Verwandlungsprozeß, den er durchmachen muß. Außer-
dem hat das Kostüm folgende Funktionen zu erfüllen: Die Be-
schreibung des Charakters der bestimmten Person (Sitz, Form und
Farbe können darüber unendlich viel aussagen!), die Kennzeichnung
des Milieus (darunter fallen Beruf, Nationalität und Klima) und
die Charakterisierung der Zeit (man darf aber nicht nur die Zeit,
in der das Stück spielt, berücksichtigen, sondern man muß auch die
Zeit des Dichters beachten. Für eine Tragödie des Sophokles würde
man z. B. andere Kostüme entwerfen als für Goethes "Iphigenie"
oder Grillparzers "Medea"). Dann entwickelte Prof. Niedermoser
vor uns noch kurz den Wandel der Mode vom Altertum angefangen
bis in unsere Zeit. Zum Schluß durften wir noch eine große Menge
Entwürfe von Schülern des Professors betrachten, die uns das eben
Gehörte noch deutlicher vor Augen führten.
Allmählich schließt sich unser Kreis. Die nächste Ringvor-
lesung fand wieder im Kainz-Raum des Instituts statt, wo Herr Doz.
Börge über das Wesen und die Kunstbetrachtung des
Films sprach. Die Dramaturgie des Films ist eine Dramaturgie
des Bildes und unterscheidet sich daher grundsätzlich von der des
Theaters. Man kann daher auch Dramen nicht ohneweiters ver-
filmen, der Film braucht viel eher einen epischen Vorwurf als einen
dramatischen. - Ein Kunstbetrachterhat sich ernstlich damit aus-
einanderzusetzen, ob der Film Kunst ist oder nicht. Vorläufig ist
der Film als Kunstwerk unselbständig, weil er immer noch literarische
Anleihen machen muß und noch keine eigenen Dichter hat. Wenn
wir vom allgemeinen Niveau des Films absehen und nur die Spitzen-
filme der heutigen Produktion betrachten, so dürfen wir hoffen,
daß der Film sich allmählich dem Kunstwerk nähern wird.
Die letzte Ringvorlesung hielt Prof. Niederführ; er
sprach über die Erziehung des Schauspielers. Erst sagte
er einiges über die Geschichte der heutigen Reichshochschule für
Musik, der die Schauspielschule des Burgtheaters angeschlossen ist.
Dann umriß er die pädagogischen Grundsätze der Schauspielschule.
Die Studierenden werden in drei Hauptfächern unterrichtet: Kör-
perliche Ausbildung, stimmlich-sprachliche Ausbildung und "dra-
matische" Ausbildung. Das letzte ist wohl das am schwersten
Lehrbare und Erlernbare. Die eigentliche "Größe" eines Schauspielers
hängt ja nie ab von seiner Erscheinung, seinen Bewegungen, seinem
Organ oder seiner Sprache, sondern von der Intensität seines
inneren Erlebens.
Der Ring ist für dieses Semester geschlossen! Zum Schluß er-
griff Herr Prof. Kindermann kurz das Wort und dankte allen Pro-
fessoren und Dozenten, die zu uns gesprochen haben. Dann gab er
bekannt, daß die Ringvorlesung eine ständige Einrichtung des
Zentralinstituts werden würde. Während sie sich in diesem Semester
hauptsächlich an die angehenden Kunstbetrachter gewandt
hat, wird sie im kommenden auf die Dramaturgen und im
übernächsten auf die Regisseure ausgerichtet sein.
Wir werden Ihnen also in Zukunft nach jedem Semester Bericht
erstatten können. - Das Zentralinstitut grüßt Sie alle recht herzlich,
und wir hoffen, daß Sie durch diese Ausführungen einen kleinen
Einblick in unsere Arbeit bekommen haben.
Institutsanschrift: Wien I, Hofburg, Batthianystiege. Ruf R-20-5-20.